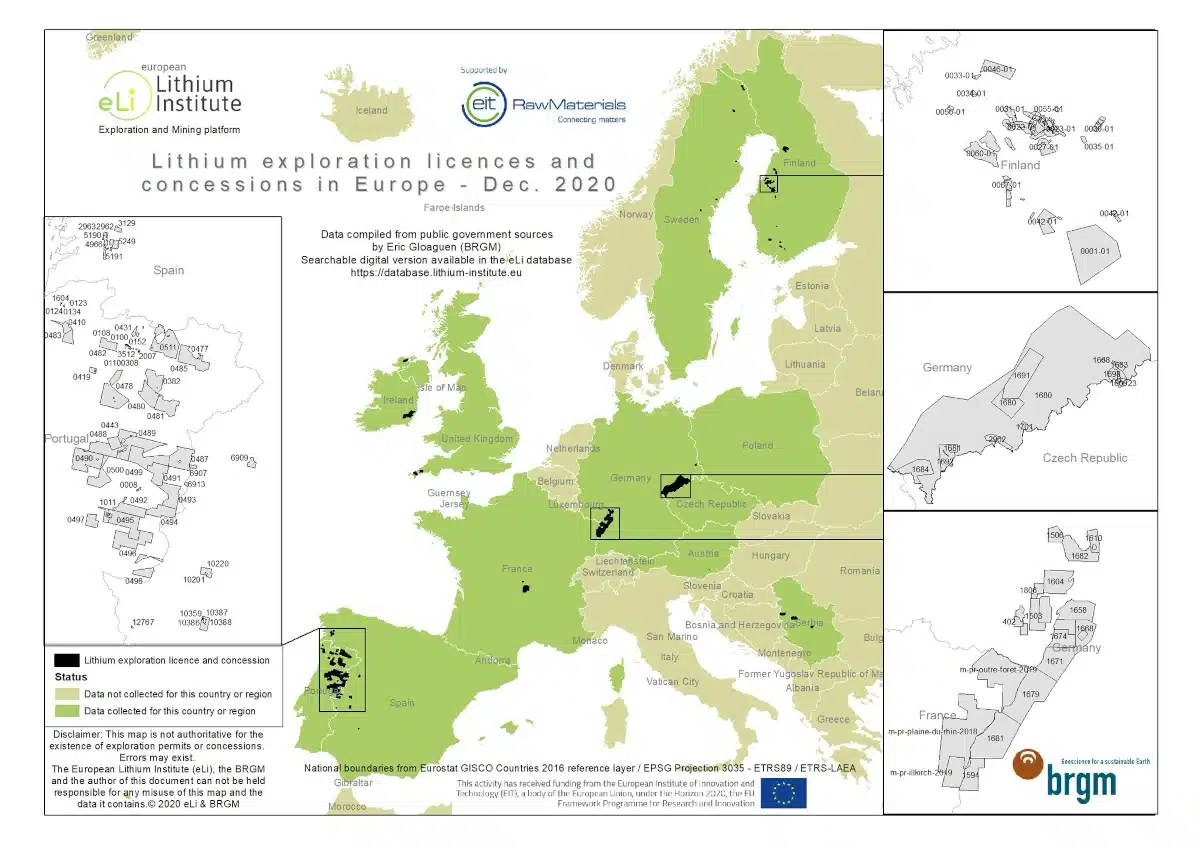Mit dem am 17. Juli in London unterzeichneten deutsch-britischen Freundschaftsvertrag
vertiefen beide Länder ihre Zusammenarbeit im Rahmen von 17 Kooperationsprojekten –
von Verteidigung und Außenpolitik bis hin zu Wirtschaft und Bildung.
Foto: Bundesregierung/Steffen Kugler
Große Erwartungen
Der Freundschaftsvertrag zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland – auch als „Kensington-Vertrag“ bezeichnet – bedeutet eine neue Dimension der Zusammenarbeit auf vielen Gebieten. Er setzt markante Impulse für ein sich weiter verstärkendes Beziehungsgeflecht, was sich insbesondere in gemeinsamen Rüstungsprojekten niederschlägt. Schon in der Trinity-House-Vereinbarung (am 23. Oktober 2024) hatten die Verteidigungsminister der beiden Länder vereinbart, deutsche Seefernaufklärungsflugzeuge (P-8A) in Schottland zu stationieren.
Der am 17. Juli zwischen dem britischen Premierminister Keir Starmer und Bundeskanzler Friedrich Merz in London unterzeichnete Freundschaftsvertrag setzt weitere Meilensteine für eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Er ist der Fahrplan für eine noch engere Zusammenarbeit bei einer Reihe von Rüstungsprojekten. Dem Abkommen wird eine Strahlkraft weit über die 2030er Jahre hinaus attestiert.
Bei den Gesprächen in London äußerten beide Seiten allerdings ihre Besorgnis über russische Bedrohungen und Zweifel an der Zuverlässigkeit der Vereinigten Staaten bei der weiteren Unterstützung der Ukraine und der Fortführung des militärischen Engagements der USA in Europa. Insbesondere auf deutscher Seite sei man besorgt darüber, dass die USA sich von Europa abwenden und den Ambitionen im asiatisch-pazifischen Raum den Vorrang einräumen könnten. Damit wäre die Stationierung von US-Truppen auf deutschem Boden in Frage gestellt. Auf ein solches Szenario müsste sich Deutschland früh genug einstellen und nachjustieren.
Noch am Rande der Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen der NATO in Washington (9. bis 11. Juli 2024) machten sich die USA unter Joe Biden stark für eine weitere Verstärkung ihres Engagements in Europa. In einer Erklärung hieß es, dass die USA ab dem Jahr 2026 Mittelstreckenwaffen auf deutschem Territorium stationieren wollen. Die Planungen hierfür wurden schon frühzeitig begonnen und mit Berlin abgestimmt. Der wiedergewählte US-Präsident Donald Trump hat sich erwartungsgemäß hierzu bislang nicht klar geäußert, allerdings über seinen Verteidigungsminister Pete Hegseth gegenüber Verteidigungsminister Boris Pistorius bei seinem unlängst erfolgten Besuch in Washington zu erkennen gegeben, dass man dem Wunsch Deutschlands, Mittelstreckenwaffen des Typs Tomahawk (Typhon) zu erwerben, entsprechen wolle.

Als Donald Trump im Januar 2025 erneut und zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, stand eines fest: Ein Abrücken von einer gemeinsam mit den Europäern abgestimmten Ukraine-Politik führt dazu, dass die europäischen Bündnispartner die Lasten der Unterstützung der Ukraine selbst tragen. Denn Trump hatte schon längst davor gewarnt, dass man die Tragweite einer solchen Entwicklung – vor allem mit dem Ausbleiben weiterer Hilfspakete aus den USA – unterschätzt habe. Die europäischen Bündnispartner hatten zulange abgewartet. Weil es an einer eigenen starken Strategie für die Ukraine mangelte, glaubte man, dass sich die USA weiterhin in Europa engagieren würden. Eine Fehleinschätzung mit Konsequenzen: Der Verlust an Glaubwürdigkeit bei den Europäern kam dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gelegen, denn er hatte schon vor dem Beginn seiner Vollinvasion in der Ukraine davor gewarnt, dass die Europäer in ihrem Beziehungsgeflecht zu den USA markante Schwächen aufweisen, also nicht in Augenhöhe agierten. Mit den allzu schwachen Sanktionierungspaketen der EU alleine ist es kaum möglich, die Kreml-Führung zum Einlenken zu bewegen. Sollten die USA ihr Engagement in Europa aufrechterhalten, bedeutet das nicht, dass die Europäer sich künftig einer Verantwortung zu entziehen versuchen.