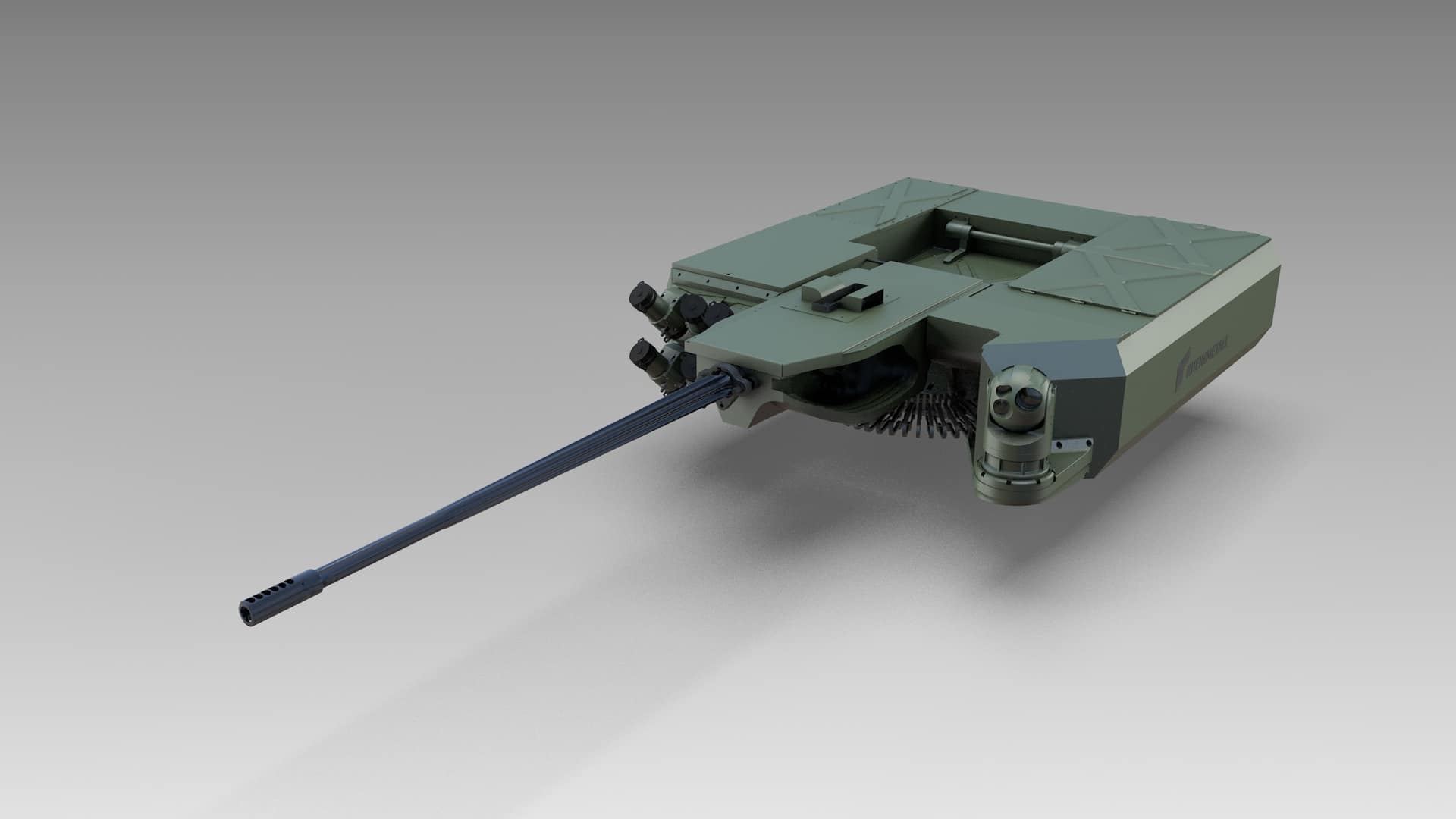Es geht auch anders: Die Werft German Naval Yards in Kiel hat unlängst
die Hauptinstandsetzungsarbeiten beim dritten Einsatzgruppenversorger (EGV)
BONN (A 1413) mit der termingerechten Ablieferung der Einheit am 7. April 2025
erfolgreich zum Abschluss gebracht.
Foto: German Naval Yards
Europaweit sehen sich Marineschiffbauer mit völlig neuen Anforderungen konfrontiert, sowohl in technischer wie auch in finanzieller Hinsicht.
Aber der Reihe nach. Die Meldung am Wochenbeginn – zwar längst erwartet – setzt Akzente – im Marineschiffbau und branchenweit. Denn in einer Pressemitteilung (vom 15. September) gibt die in Bremen-Vegesack ansässige Unternehmensgruppe Lürssen bekannt, dass sie ihre Marine-Schiffbausparte NVL (Naval Vessels Lürssen) an den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall verkaufen will. Den allermeisten ist bekannt, dass die traditionsreiche Werftengruppe – ein familiengeführtes Unternehmen – mit ihrer Marinesparte NVL längst zu einem national wie international bedeutenden Player auf dem Gebiet des Designs und Baus von Marineschiffen aller Art avanciert ist. Die Deutsche Marine gilt hierbei als einer der wichtigsten Kunden – nicht nur beim Neubau von Überwasserschiffen (2. Los Korvette Klasse 130, Flottendienstboot Klasse 424, Marinebetriebsstoffversorger Klasse 707), sondern auch auf dem Gebiet des Reparaturgeschäfts. Zukünftig will sich Lürssen ausschließlich auf den Bau ziviler Megayachten konzentrieren, heißt es in der Verlautbarung. Wie die Werft mitteilt, plant Rheinmetall sämtliche Standorte und Mitarbeitenden der NVL zu übernehmen und sie mitsamt ihrem bisherigen Management als eigene Division in den Rheinmetall-Konzern zu integrieren und weiterzuentwickeln. Peter Lürßen, Geschäftsführender Gesellschafter der Lürssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co. KG benennt rund 2.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit dem Verkauf „in gute und verlässliche Hände gegeben werden.“ Abschließend sei vermerkt, dass Lürssen mit dem Verkauf, der in den nächsten Wochen – vorbehaltlich der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden – formal abgeschlossen werden soll, ein Zeichen der Stärke setzen und den Weg für die politisch seit langem gewünschte Konsolidierung in der deutschen Verteidigungsindustrie ebnen will.
Auf dem Höhepunkt dieses Sommers jedoch geriet einer der führenden europäischen Marinewerften, nämlich Damen Naval in den Niederlanden, unter enormen Druck, was den Bau eines der wichtigsten europäischen Kampfschiffprogramme, der deutschen Fregatte F126, verzögern könnte. .

Rückblick: Im Juni 2020 unterzeichneten Damen Naval (Damen Group) und das Beschaffungsamt einen Vertrag über die Konstruktion und den Bau von zunächst vier Mehrzweckkampfschiffen vom Typ MKS 180, die später in Fregatte Klasse 126 (F126) umbenannt wurden. In einem Anschlussvertrag wurde die Ablieferung zweier zusätzlicher Fregatten vereinbart. Ohne aber näher auf das Projekt einzugehen, scheint Damen Naval mit einer Reihe von operativen Herausforderungen konfrontiert zu sein, die möglicherweise dazu geführt haben, dass die Werft wichtige Fristen nicht einhalten konnte – der oder ein Hauptgrund für die Aussetzung der Zahlungen durch die deutsche Regierung.
Nicht nur seit der Corona-Pandemie sind die Unternehmen der europäischen und deutschen Marineschiffbauindustrie sowohl technologischen als auch finanziellen Risiken ausgesetzt. Dies geschieht oft inmitten günstiger Marktbedingungen, die durch erhöhte Verteidigungsausgaben aufgrund geopolitischer Instabilität und Krisen bedingt sind. Im Fall von Damen Naval bedeutet ein gut gefülltes Auftragsbuch nicht, dass kritische Faktoren wie steigende Materialkosten, Arbeitskräftemangel, kontinuierliche Designänderungen und grundlegende Designprobleme keinen Einfluss auf den Bauprozess und den Zeitplan bei großen Bauvorhaben – wie die F126 – hätten. Im Fall von Damen Naval könnten Verkäufe von Marineschiffen jeder Art in Afrika, Asien, Südamerika und Europa gefährdet sein. Die Werft hat jedoch immense Summen in neue Technologien investiert, um neue – und im weltweiten Vergleich – technologisch einzigartige Überwasserschiffe zu bauen – viele davon stehen auf den Wunschlisten internationaler Kunden.
Tatsächlich aber ist Damen Naval nicht der einzige Global Player auf dem Gebiet von Marinekampfschiffen. Marinewerften wie Damen Naval und andere in Europa sehen sich neuen Herausforderungen konfrontiert: der Arbeitskräftemangel, die Verfügbarkeit von kritischen Vorstoffen (Stichwort kritische und strategische Metallrohstoffe), steigende Produktionskosten.
Ein Beispiel zeigt die Notwendigkeit des Gegensteuerns: Der eingeleitete Modernisierungsprozess bei thyssenkrupp Marine Systems wird durch Neuentwicklungen in den Bereichen Stealth-Technologie, Brennstoffzelle, Lithium-Ionen-Batterie, Additive Fertigung (3D-Druck), Cyber-Security sowie die Nutzung von Virtual-/Augmented Reality zur Unterstützung von Produktionsprozessen und Training sichtbar. Dank der Integration von ATLAS ELEKTRONIK ist die Entwicklung der heutigen TKMS vom Plattformanbieter zum ganzheitlichen „Maritimen Systemhaus“ gelungen. Kennzeichnend hierfür ist das von kta naval systems – ein Joint Venture zwischen TKMS und Kongsberg Defence & Aerospace – für die neuen deutschen und norwegischen Uboote entwickelte ORCCA-Combat System.
Damit sind einige der bedeutungsvollsten Einflussfaktoren genannt. Sie kennzeichnen die neue Ära im deutschen Marineschiffbau. Nur durch eine starke Unterstützung durch die Politik und durch solide Anpassungsmaßnahmen bei den Werften wird man den Herausforderungen des Marktes in den kommenden zehn bis 20 Jahren effektiv begegnen können. Der nationale Marineschiffbau wird diese Herausforderungen nur durch das Erschließen der großen Technologietrends – Augmented Reality, künstliche Intelligenz, Machine Learning, Big Data, IoT (Internet of Things) und 3D-Druck – bewältigen können. Ein starker Fokus liegt dabei auf dem Gebiet von Forschung und Entwicklung (F&E). Innovatives Design, neue Fertigungsmethoden, neue Materialien und Strukturen sowie verbesserte logistische Konzepte (Ersatzteilversorgung) nehmen Einfluss auf die Machbarkeit großer Bauvorhaben – und damit auf schnellere Produktionsprozesse, beschleunigte Wartungs- und Modernisierungsmaßnahmen (Stichwort MRO) und reibungslose Ablieferungen an den Kunden.